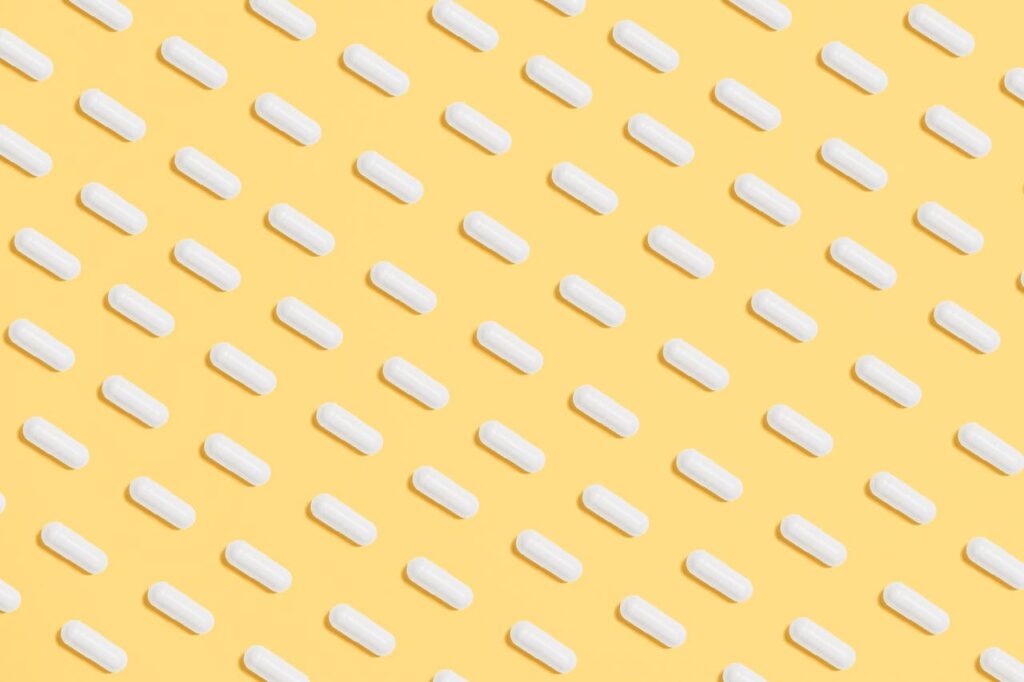In einer Welt, die immer schneller, komplexer und fordernder wird, ist es wichtiger denn je, auf das eigene psychische Wohlbefinden zu achten.
Was ist der WHO-5 Fragebogen?
Der WHO-5 Well-Being Index ist ein kurzer, standardisierter Fragebogen, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt wurde. Ziel ist es, das subjektive psychische Wohlbefinden einer Person zu erfassen – und das in weniger als einer Minute.
Er besteht aus nur fünf Fragen, die sich auf die letzten zwei Wochen beziehen und positive Aspekte des Erlebens abfragen. Die Fragen lauten:
- Ich habe mich fröhlich und gut gelaunt gefühlt.
- Ich habe mich ruhig und entspannt gefühlt.
- Ich hatte genug Energie für den Alltag.
- Ich hatte ein gutes Selbstwertgefühl.
- Mein Alltag war voller Dinge, die mich interessieren.
Wie funktioniert die Auswertung?
Die Antworten werden auf einer sechsstufigen Skala bewertet:
Die Gesamtpunktzahl liegt zwischen 0 und 25. Je höher der Wert, desto besser das subjektive Wohlbefinden. Die Punktzahl liefert eine erste Einschätzung des psychischen Zustands:
- 19–25 Punkte: Sehr gutes Wohlbefinden
- 13–18 Punkte: Zufriedenstellendes Wohlbefinden
- 10–12 Punkte: Hinweis auf reduziertes Wohlbefinden
- Unter 10 Punkte: Deutlich eingeschränktes Wohlbefinden
- Unter 7 Punkte: Verdacht auf klinische Depression
Wichtig: Der WHO-5 ist kein Diagnoseinstrument, sondern ein Screening-Tool. Bei auffälligen Werten sollte eine weiterführende Diagnostik durch Fachpersonal erfolgen.
Einsatzgebiete und Vorteile
Der WHO-5 wird weltweit in über 30 Sprachen eingesetzt und ist besonders beliebt in der Psychiatrie, Psychotherapie, Allgemeinmedizin und Forschung. Seine Vorteile:
- Schnell und einfach: Bearbeitungszeit unter einer Minute
- Wissenschaftlich validiert: Hohe Aussagekraft in Studien
- Kostenlos verfügbar: Für Fachleute und Privatpersonen
- Breit einsetzbar: Für Erwachsene, Jugendliche und sogar Kinder
Medien
Den Fragebogen gibt es zum Beispiel bei der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Psychologie, DDG als Online-Abstimmung mit Auswertung oder auch bei der WHO als PDF-Datei zum Ausdrucken in verschiedenen Sorachen
Kleine Fragen, große Erkenntnisse
Der WHO-5 Fragebogen zeigt, wie effektiv einfache Mittel sein können, um das psychische Wohlbefinden zu erfassen. In Zeiten, in denen mentale Gesundheit immer mehr in den Fokus rückt, bietet er eine wertvolle Möglichkeit zur Selbstreflexion – und kann ein erster Schritt sein, um Hilfe zu suchen, wenn sie gebraucht wird.